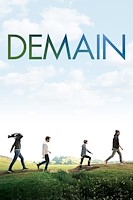Demain
Mélanie Laurent, Cyril Dion, Frankreich, 2015o
Was, wenn es eine Formel gäbe, die Welt zu retten? Was, wenn jeder von uns dazu einen Beitrag leisten könnte? Die Schauspielerin Mélanie Laurent und der französische Aktivist Cyril Dion sind nicht daran interessiert, Katastrophenszenarien zu verbreiten, sondern interessieren sich für konkrete Lösungen. Sie machen sich auf den Weg, um mit Experten zu sprechen, besuchen weltweit Projekte und Initiativen, die alternative ökologische, wirtschaftliche und demokratische Ideen verfolgen.
Müll trennen ist eine gute Sache, als besonders hip gilt es nicht. Im Film der Schauspielerin Mélanie Laurent und des Aktivisten Cyril Dion ist das anders. Sie suchen weltweit nach Lösungen, den Klimawandel zu stoppen, und schaffen es tatsächlich, die diversen Ideen ziemlich gut aussehen zu lassen. Vielleicht wird Grün ja wirklich das neue Schwarz? In Frankreich jedenfalls haben schon mehr als 800 000 Zuschauer den Film gesehen.
Martina KnobenEt pourtant, la grande pertinence de Demain, c’est de démontrer que toutes ces initiatives ont un point commun : privilégier le petit, le local et l’investissement des citoyens plutôt que leur assentiment passif.
Arnaud GonzagueLe puzzle éclaté des milliers d'initiatives prend forme et permet de croire que c'est possible. Et puis il y a les « héros » : pas de bon documentaire sans bons personnages. Parmi eux, le Britannique Rob Hopkins impose son humour et son esprit aussi incisif que constructif.
Weronika ZarachowiczGalerieo